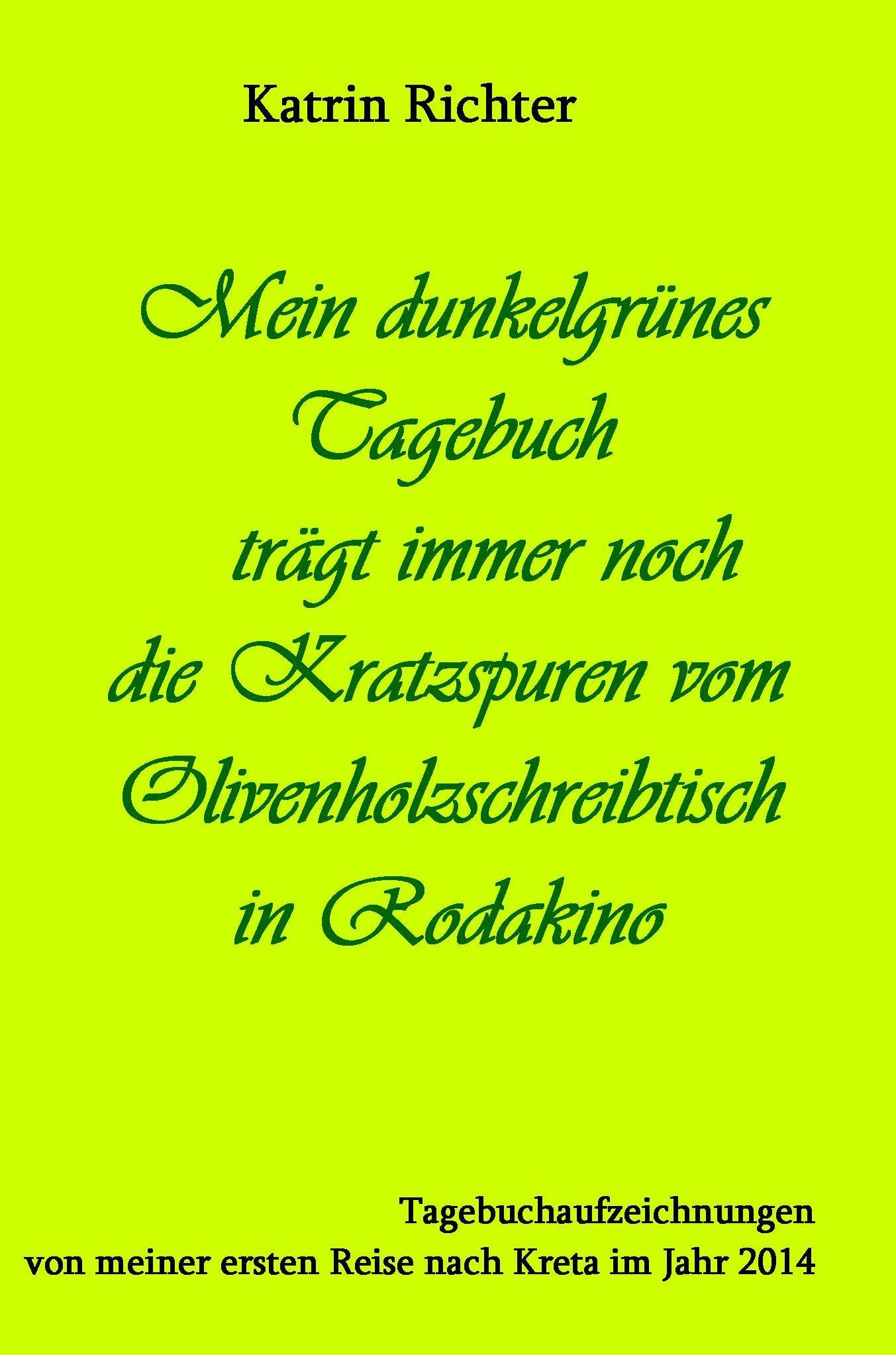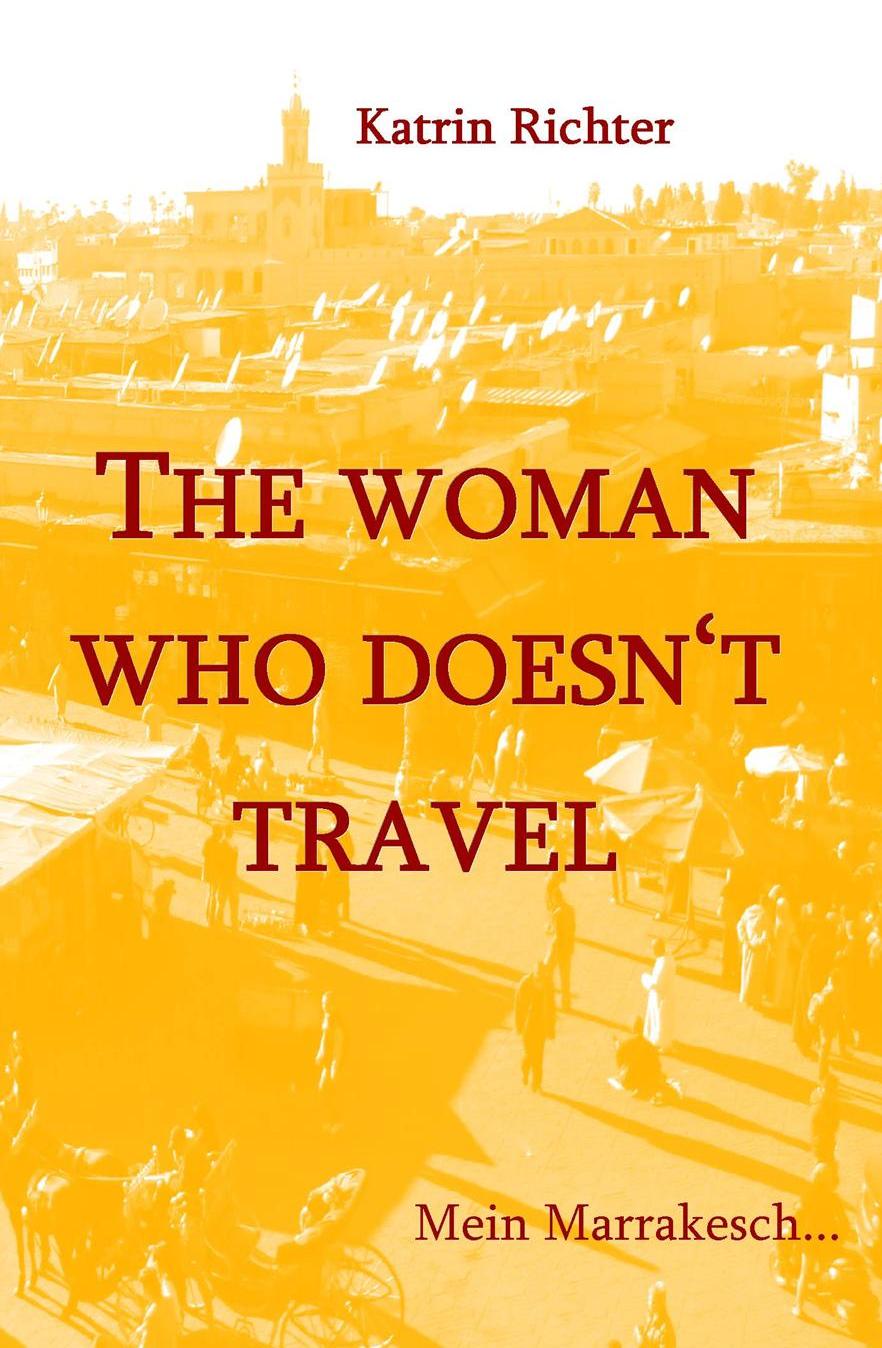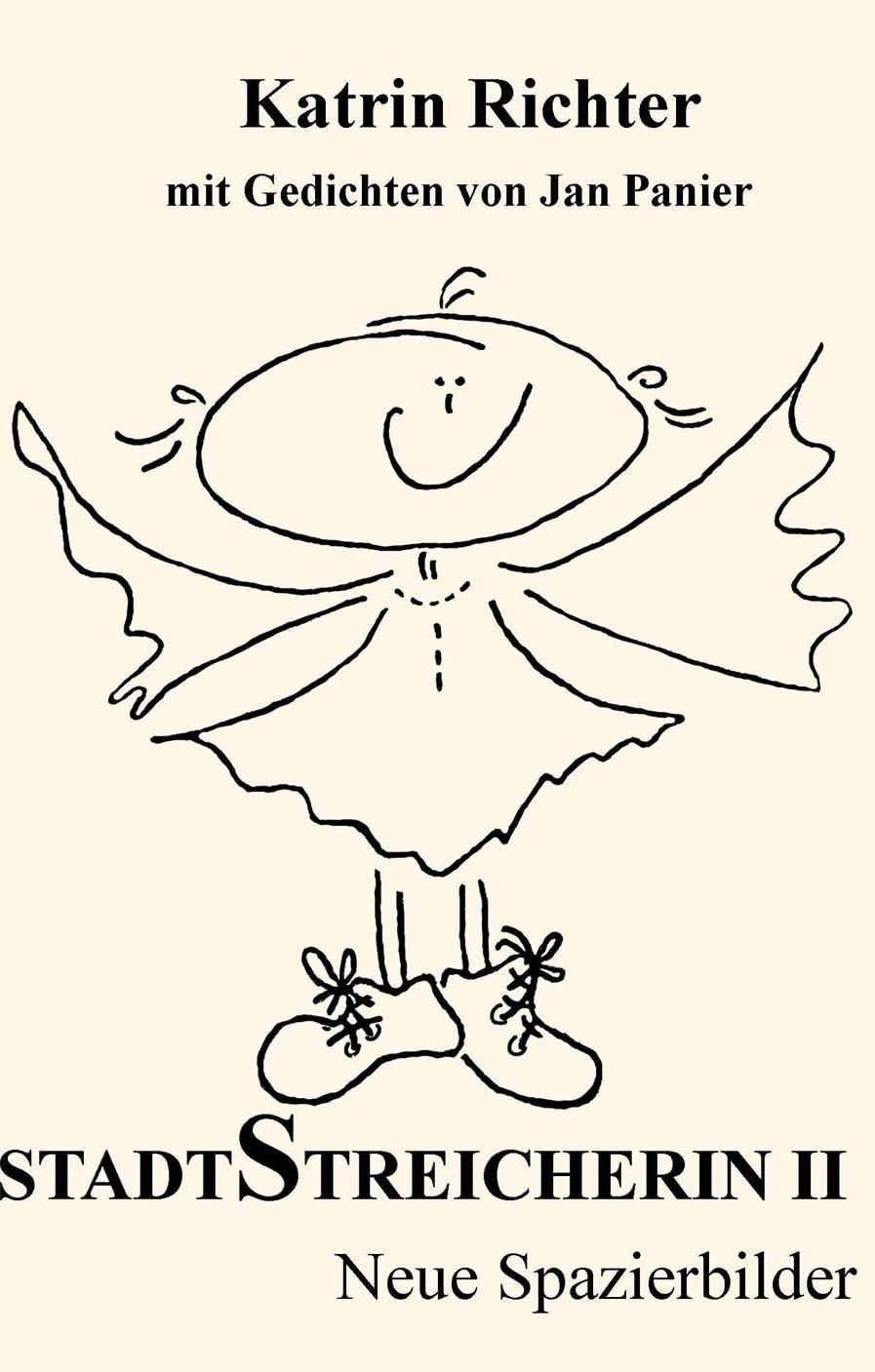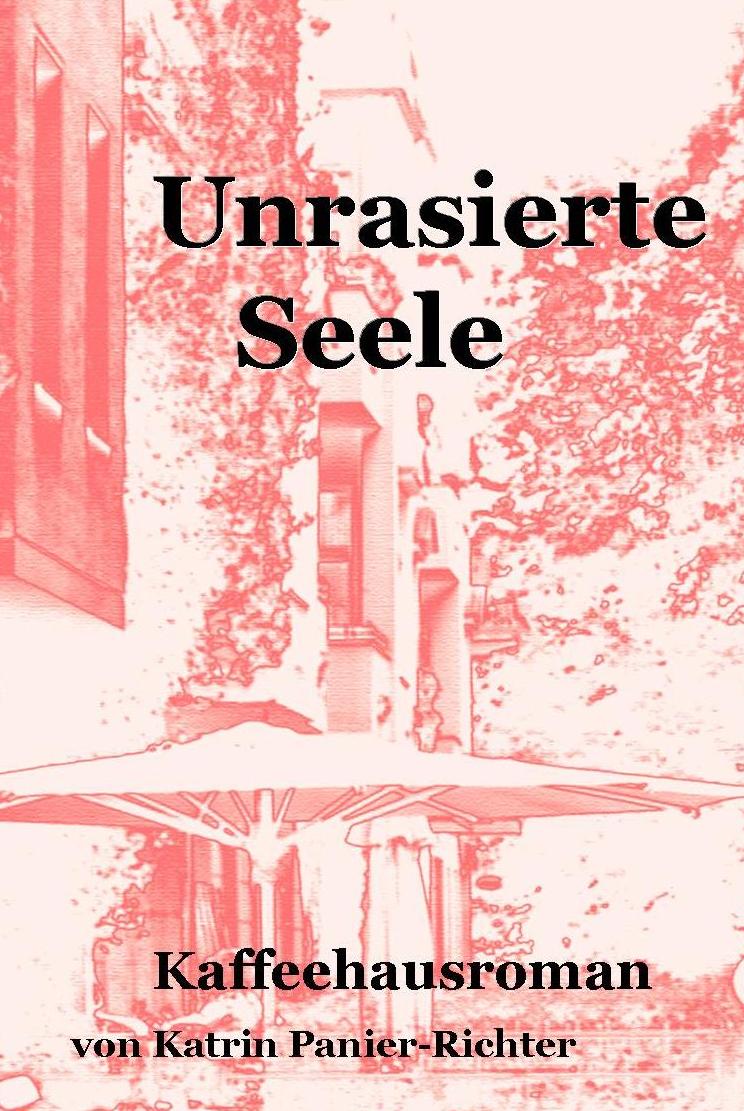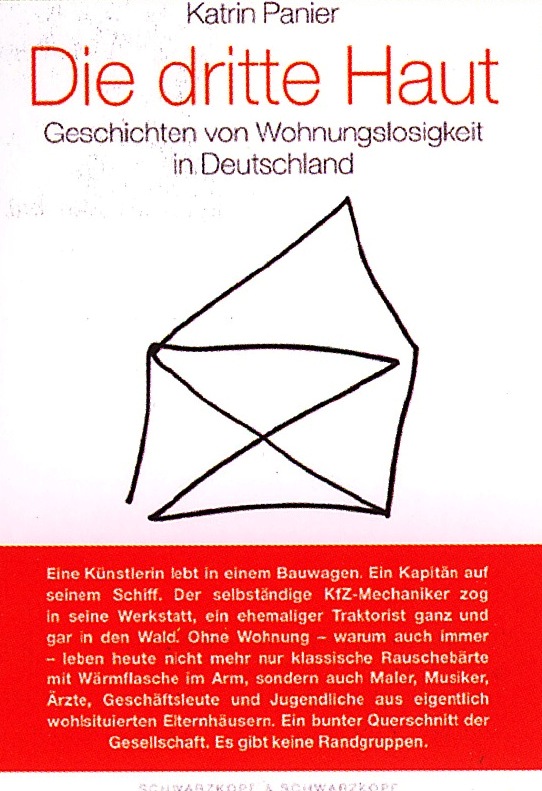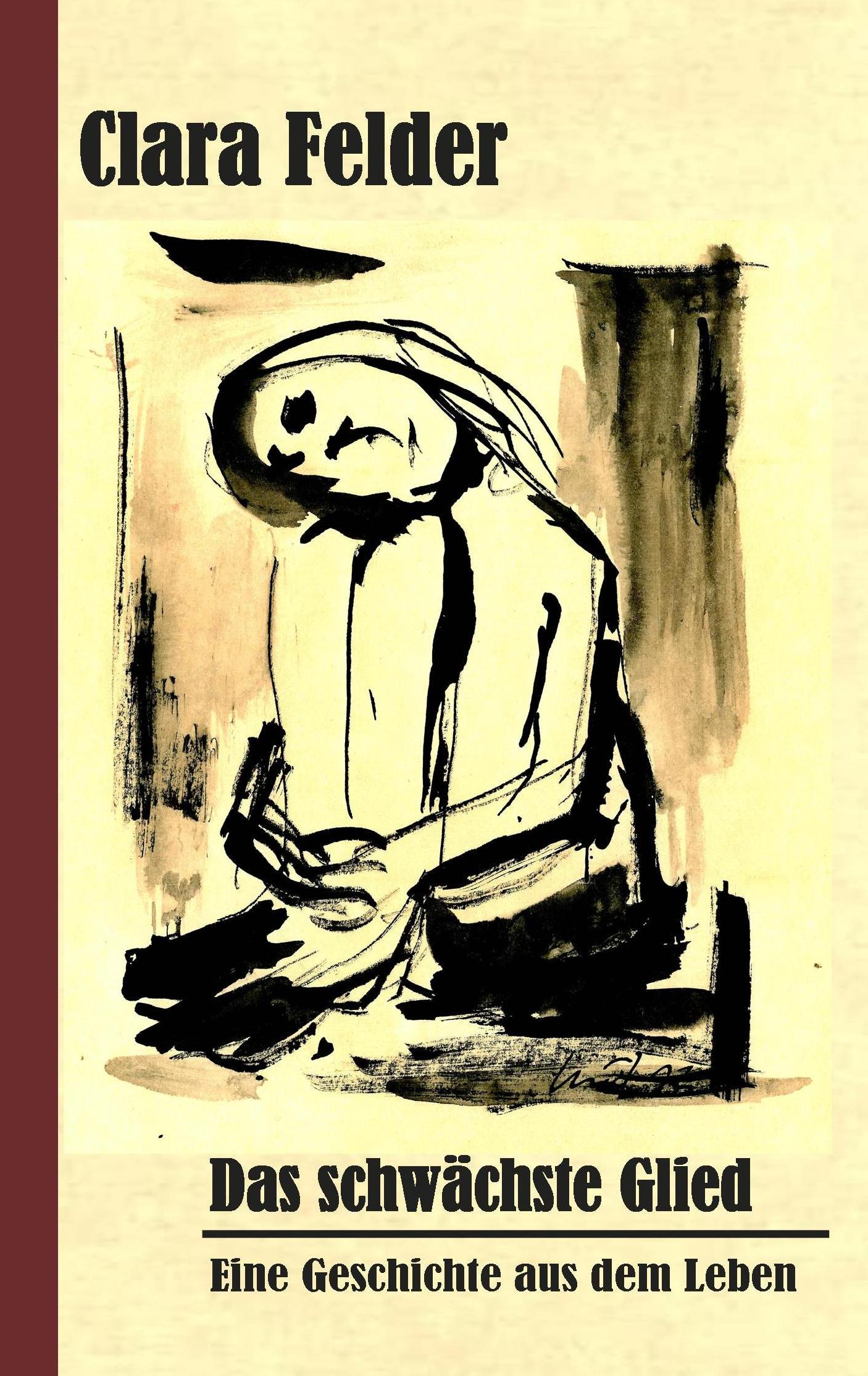Die Geschichte meiner Bücher und der vier Namen
Wenn ich mich irgendwo, irgendwem als Schriftstellerin vorstelle, dann lautet die erste Frage, die zu mir zurück kommt, meistens: „Ach – und was schreiben Sie so?“
„Alles außer Krimis“, habe ich mir mit der Zeit angewöhnt, darauf zu antworten. „Ich kann niemanden umbringen, nicht einmal im Buch.“ Das ist wahr. Aber eine Negation ist natürlich immer noch keine Beschreibung. Was also tue ich da nun die ganze Zeit – seit ungefähr fünfzehn, sechzehn Jahren? Ich gehöre in keine Schublade. Ich habe mich entwickelt.
Es ist für mich selbst interessant, an dieser Stelle Inventur zu machen und mal genau hinzusehen, wie alles kam, warum ich ausgerechnet diese neunzehn Bücher schrieb, veröffentlichte; und wieso, um alles in der Welt, ich unterwegs dreimal meinen Namen wechselte. Das tut man nun schon gar nicht. Von wegen „ich kann keinen morden“! Wenn man den Ratschlägen mancher Zeitgenossen Glauben schenken möchte, dann hätte ich auf diese Weise meine eigene literarische Laufbahn erdolcht. Wer seinen Namen ändert und damit sein Erkennungszeichen, der ist dazu verdonnert, wieder ganz von vorne anzufangen, hörte ich und bekam natürlich Angst. Nein, das wollte ich nun auch wieder nicht, mich selbst und meine Karriere willentlich zu sabotieren, gar zu strangulieren. Aber, auch meine zu den Büchern parallel laufende Biografie ist keine Geschichte von Mord und Totschlag meiner selbst; ich finde: Ganz im Gegenteil. Genau so stark wie mein Wille zum Schreiben ist der, mein Wesen nicht zu verraten, mir treu zu sein. Und so lief eben alles, wie es lief. Ich bereue nicht einen Schritt, den ich getan habe. Ich bin´s zufrieden.
Und so kam alles ...
Am Anfang bibberte eine gestandene, diplomierte, vom Leben leicht verbeulte Radiojournalistin mit einer unerfüllten Sehnsucht in der Brust. Bestimmung ist ein großes Wort; aber für mich enthielt es Sinn. Wenn nur die Angst vor meiner eigenen Courage nicht gewesen wäre – und das Zweifeln an meinen Fähigkeiten. Aber das Leben verbeult nicht nur den Panzer, es kommt auch zu Hilfe. Eines Tages fand mich die Idee, mit einer Kollegin gemeinsam unsere schönsten Radiosendungen – es waren lange Features, also jede Mühe wert – abzuschreiben und in eine Buchform zu bringen. Da ich zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig echte Fügungen von eingebildeten unterscheiden gelernt hatte, witterte ich eine echte – und begann. Die Hürden, die wir beim Prozess zu überwinden hatten, lasse ich mal aus (ich kann sie ja bei Interesse eines Tages am Rande von Veranstaltungen erzählen); am Ende stand – und nur das zählte – ein erstes tatsächliches Werk aus Pappe und Papier, das ich anfassen konnte und aufblättern. Welch Hochgefühl! Ein allererstes Buch, an dem auch ich beteiligt war; an dem ich zumindest mitgeschrieben hatte. „Frauen in Brandenburg. Pique Dame – das Buch zur Sendung“. Ich weiß nicht, ob es beim rbb oder bei Antenne Brandenburg noch irgendwo erhältlich ist. In mir erzeugte es jedenfalls etwas, das ich in Worten ungefähr so auszudrücken vermag: „Jetzt oder nie! Du bist auch gleich vierzig, also wenn du es irgendwann noch einmal wissen möchtest, dann warte nicht zu lange damit. Bleib am besten gleich am Schreibtisch sitzen und schreib auf, was du zu sagen hast.“
Eine Geschichte gab es, die noch unerzählt geblieben war; eine DDR-„Wende“- und Suchtgeschichte. Mich dieser zu stellen, warf mich erst einmal auf die Bretter. Ich wurde krank. Da dies mit einem ersten Heiratsantrag zusammen fiel, den ich ablehnte (aus Angst), kam leider bei meinen Kindern die subtile Botschaft an: Eheabsichten machen krank. Ich hoffe, sie erholen sich davon.
Wieder auf den Beinen und am Computer, schrieb ich mein erstes Buch zu Ende. Ein Triumph für mich, eher kein abzusehender für alle von mir angeschriebenen Verlage. Zwei Jahre lang sagten sie mir alle ab; bedeutende wie kleinere. Ich habe die Formbriefe in einem dicken Ordner gesammelt. „Bei der Fülle der Einsendungen, die wir jeden Tag bekommen, können wir nicht jede unserer Entscheidungen begründen ... wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei einem anderen Verlag.“ Die Welt hatte nicht auf mein Manuskript gewartet. Ganz klar.
Und so kochte ich eben weiter mittags Spaghetti für die pubertierenden Kinder und ihre Freunde, saß mit ihnen zusammen, wenn sie aus der Schule kamen, redete und lachte wie sie. Fühlte mich ihnen verbunden, weil auch sie so störrisch mit der eigenen Verletzlichkeit umgingen wie gerade eben ich.
Mich interessierte, was die jungen Leute zu sagen hatten. Und an einem Tag kam Eins und Eins zusammen; ich bot meine neue Idee einem jener Verlage an, die zuvor mein erstes Buch abgelehnt hatten: Ich wollte Tonbandprotokolle Jugendlicher aus ganz Deutschland aufschreiben, so ehrlich und ungeschönt wie möglich. Mir schwebte die Nachfolge von Maxie Wander vor, eines meiner literarischen Vorbilder, falls es so etwas überhaupt gibt. Ihre Frauenporträts „Guten Morgen, du Schöne“ hatten mich – seit ich sie lesend verstehen konnte – begleitet und tief berührt.
Dieses Mal war ich die richtige Frau mit der richtigen Idee am richtigen Ort. Ein Volltreffer! Und eine riesige Chance. Es war der Juni 2002; und der Verleger Oliver Schwarzkopf bot mir an, wenn ich mich beeilen würde und bis Weihnachten ablieferte, dann könnte mein Buch schon zur Frühjahrsmesse in Leipzig erscheinen. Das brauchte er mir nicht zweimal zu sagen. Ich begann zu arbeiten wie selten in meinem Leben. Inspiriert, kraftvoll, auf ein selbst gestecktes Ziel zu. Auch hier lasse ich mal die Schwachstellen aus, jene Punkte, an denen ich meinte, es würde doch nichts, der Traum sei zu groß, ich müsste aufgeben, leider. In der Rückschau spielen die bangen Stunden keine Rolle mehr; es zählt nur das Ergebnis, ein fertiges Buch. Und wirklich: Ich saß neben dem Verleger auf der Buchmesse 2003 am Lesungstisch vor Publikum. Wir hielten stolz ein dickes Kompendium in die Höhe; eine reiche Sammlung jugendlichen Lebensgefühls im Hier und Heute.
„Und warum ist da kein Türke drin?“, störte mich die Frage eines Journalisten in meiner Freude auf. Ja – warum eigentlich? Mir war nicht in den Sinn gekommen, während all dieser intensiven Arbeitsmonate, einen jungen Ausländer zu befragen; und selbst, wenn: Es wäre mir vorgekommen wie einen „Quoten“-Migranten mit in mein Werk zu holen.
Nun aber wurde die Frage zur nächsten Inspiration: „Wollen wir das Gleiche noch einmal tun und in einem Jahr an dieser Stelle präsentieren?“ Die Frage des Verlegers vor all den Leuten bedurfte keiner Bedenkzeit. Ja, ich will. Was ich beim Heiraten noch nicht schaffte; beim Arbeiten gelang es mir mit Leichtigkeit. Und welche Aussicht! Es würde wieder ein Buch von mir geben. Ich hatte einen Verlag, der mir das garantierte. Es war der Himmel auf Erden.
Zusätzlich gab mir mein Verleger noch einen Tipp: Books on Demand sei eine seriöse Art für Autoren, kleine, dünne Bücher preisgünstig und lohnend selbst herauszugeben. So nahm ich es zum ersten Mal in Angriff, selbst ein Manuskript zur Welt zu bringen wie ein Baby. Unter Schmerzen, mit Geduld, Einsatz, Fürsorge und der Hilfe von Freunden, „Hebammen“ und „Hebammerichen“, die den Text lasen, korrigierten, in die richtige Form brachten und mich technisch berieten. 2004 wurde also zu dem glanzvollen Jahr, in dem es schon vier Bücher von mir gab, das erste über unsere schönsten Radiosendungen mit eingerechnet. Ich war nicht mehr zu bremsen.
Ein Weihnachtskonzert im Frauengefängnis brachte die Idee, Geschichten von Insassinnen zu sammeln und aufzuschreiben; man hielt mich für die richtige Person dafür. Es schien auch zu stimmen, denn erstens hatte ich Lust dazu – und zweitens stellte sich mein selbst verlegtes Buch als eine Art Eintrittskarte zum Vertrauen der verletzten und andere verletzenden weiblichen Seelen hinter Gittern heraus. Ich las zweimal daraus, und meine potentiellen Gesprächspartnerinnen meldeten sich freiwillig. Selten hat mich eine Arbeit so viel Kraft gekostet wie die für „Die schlimmsten Gitter sitzen innen“. Aber wie üblich, möchte man gerade so eine Arbeit im ganzen Leben nicht mehr missen. Die Unsichtbaren wissen, wie sehr ich jeder dieser Frauen alles Gute wünsche, heute noch, auf ihrem besseren Weg. Und wie ich mich gleichzeitig machtlos fühle, weil ich keinem Menschen wirklich helfen kann. Außer mir selbst.
Das war vielleicht – bestimmt! – auch meine tiefere Absicht (mir selbst zu helfen), als ich mein viertes Interview-Buch plante. Als Freiberuflerin ließ ich mich zuweilen von erdrückenden Existenzängsten übermannen. Ich schwebte im Zwiespalt zwischen Schöpfermut und – ehrlich gesagt – nicht ganz adäquaten finanziellen Rückfluss. Dass wir hoffentlich nicht eines Tages „unter der Brücke“ landen, ist eine ganz normale Redewendung unter Meinesgleichen. Wir wenden sie an wie einen Bannspruch. Als könnten wir so das Schlimmste verhindern.
Ich wollte mich nicht nur auf Worte verlassen; mich drängte es zu nächsten Taten. Und so folgte ich dem pragmatischen Teil in mir, der mir riet, doch einfach genau hinzuschauen, was geschieht, wenn alle Stricke reißen, wie denn das Leben so ist, dort „unter der Brücke“. So näherte ich mich meinem Buch „Die dritte Haut“ an, in dem ich wahre Geschichten von Wohnungslosigkeit in unserem reichen Deutschland erzählte, freiwillige und unfreiwillige.
Während dieser Arbeit bekam ich einen neuen Heiratsantrag. „Ja“, beantwortete ich diesen, der mir kniend auf dem Küchenfußboden dargebracht wurde. „Aber bitte nicht sofort.“ Immer noch wollte ich eine Karenzzeit wahren, brauchte ich einen Verlobtenstatus. Er und ich, wir befanden uns ja auch „erst“ seit sechzehn Jahren in der „Probezeit“, hatten Kinder miteinander groß gezogen, eine schwere Krankheit gemeinsam durch gestanden, Höhen und Tiefen miteinander geteilt. Aber ich bat mir immer noch Raum aus. Als hätte ich geahnt, dass mit dem Heiraten noch mehr auf mich zukommen würde als nur das Ja-Wort. Kann man so etwas in tiefen Schichten „wissen“?
Das Obdachlosenbuch erschien, ich heiratete den Mann meines Herzens. Ein lange gehütetes Familiengeheimnis tauchte auf, und ich nahm einen Doppelnamen an, obwohl ich die Unentschiedenheit von Bindestrich-Nachnamen eigentlich gar nicht mag. Ich hatte meine Gründe dafür, die später von mir abfielen, weswegen ich den einen Namen dann auch noch hinter mir ließ. Kommen Sie noch mit? Ich habe darüber geschrieben, in meinem Erzählband „Stadtstreicherin 2“. Aber soweit sind wir ja noch nicht, wenn ich weiter chronologisch vorgehen will.
Noch war ich nicht fertig mit meiner Maxie-Wander-Form, den Tonbandprotokollen, aus denen ich Geschichten schrieb. Eine fünfte Idee tauchte aus mir auf, die auch damit zu tun hatte, dass ich an diesem Punkt meines Lebens mein eigenes Verhältnis zur Psychotherapeutenzunft noch einmal überprüfen wollte. Das ist ja oft so: Wiedervorlage eines Themas auf neuer Entwicklungsebene, von einem anderen Standpunkt aus. Außerdem erhoffte ich mir – wenn es passen würde – vielleicht einige kleine Hinweise, mein Familiengeheimnis betreffend. Ich hatte nicht den Leidensdruck zu einer echten Therapie; für wohldosierte Ratschläge, Rückmeldungen war ich jedoch offen. Und so bat ich sie, die geduldigsten Zuhörer unserer Tage, die Psychologen und Psychotherapeuten, auf meine Couch. Ich bekam viel von ihnen, Offenheit, Vertrauen, intime Aussagen unter dem Schutz der Anonymisierung. Ich bin bis heute dankbar für eine solche Erfahrung. „Mit einem Bein auf der Couch“ ist immer noch sehr beliebt, vor allem unter Studenten der Psychologie. Wie die meisten meiner Bücher ist auch dieses mittlerweile als E-Book erhältlich.
Für dieses Werk verlor allerdings der Verleger ein wenig die Geduld mit mir. Ich solle doch lieber mal einen Bestseller schreiben, erschallte sein Rat an mich; und ich hatte dem nichts entgegen zu setzen. Nahm ich etwa jeden Morgen wieder an meinem Sekretär Platz, mit der festen Absicht, auf gar keinen Fall heute einen Bestseller zu verfassen?
Ich habe wirklich alles versucht, um ihn oder einen seiner Kollegen von meinem Therapeutenbuch zu überzeugen. Am Ende produzierte ich es selbst, und das tue ich bis zum heutigen Tag. Wundersamerweise werde ich neuerdings von anderen Autoren konsultiert und von Instituten zu wissenschaftlichen Umfragen für Buchmessen gebeten, was das Self Publishing angeht. Dreht sich da womöglich etwas? Die Frage, ob ich glaube, dass im Zeitalter des Internets das Selbst Veröffentlichen peu a peu die klassischen Verlage ersetzen könnte, wird mir jedenfalls immer öfter gestellt ... Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Was mich angeht, bin ich einfach froh, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe und ihn gehen kann. With a little help from my friends. Ich bin glücklich über Eure Unterstützung und dankbar für meine künstlerische Freiheit. Diese Arbeitsplatzbeschreibung passt nur für mich, sage ich gern, wenn ich danach gefragt werde. Und das stimmt. Das ist wahr, wahr, wahr.
Eines Tages habe ich damit begonnen, meinen literarischen Erfolg nicht mehr an äußerlichem Beifall zu bemessen, sondern am eigenen Wohlbefinden. Was ist wichtig für mich? Womit geht es mir wirklich gut?
Das ist bei mir zum Beispiel die Zurückgezogenheit, die Stille, in der ich lebe, der Frieden, der mich umgibt. Und so kehrte ich mit meiner „Stadtstreicherinnen“- Trilogie auch zu mir selbst zurück. Randvoll mit all den fremden Lebensgeschichten lief ich los, kreuz und quer durch meine selbst gewählte Heimatstadt Berlin, immer zu Fuß – und sammelte, was ich sah, innen und außen. Im Grunde tue ich auch das bis heute.
Es kamen unverhofft auch Reisen hinzu, obwohl das Fliegen, Eintauchen in fremde Kulturen, mich Zurechtfinden dort, wo ich noch nie gewesen war, mein ehemaliges Selbstbild mit einem lauten Knall in tausend Stücke sprengten. So schrieb ich über Dubai, Marrakesch, über Mallorca, Kreta – und dann wieder über den Tollensesee bei Neubrandenburg. Und schrieb doch gleichzeitig immer über mich. Mein Blick geht nach innen wie nach außen; aber das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt.
In der Etage unter mir wird ein Café eröffnet. Ich fürchte um meine kreative Ruhe – und nehme es als Inspiration. So entstand mein Kaffeehausroman „Unrasierte Seele“:
Mein Liebster geht plötzlich los, um ein Jahr lang jeden Tag seinen Lieblingsbaum zu fotografieren, durch die Jahreszeiten hindurch. Wir kombinieren seine Bilder mit meinen Tagebucheinträgen, und so entsteht „Spuren der Verwandlung. Ein Baum- und Menschentagebuch“.
Er muss dienstlich verreisen, ich bleibe traurig als Strohwitwe zu Hause zurück. Da taucht in mir die Frage auf, wer eigentlich die weiteren, anstrengenderen Reisen unternimmt: Der, der sich in die Ferne begibt – oder der, der versucht, sich selbst zu erkennen. Ich erzählte es, im „Hierbleibebuch“, „Ich war nicht in Dubai“ (und dann – ein paar Monate später – war ich doch dort, holte mir die Inspiration für meinen Roman „Sieben und eine Nacht“).
Ich wäre damit einverstanden, wenn es immer so weiter ginge. Ich fühle mich im Fluß, ich habe keine Ahnung, was ich in zehn Jahren schreibe. Vielleicht am Ende doch noch Krimis? Kann ich das ausschließen? Ich glaube, nicht.
Aber diese Arbeitsplatzbeschreibung passt nur für mich. Das weiß ich sicher. Jedenfalls für den Moment.
Vor einigen Jahren habe ich einmal das Folgende in mein Notizbüchlein geschrieben:
„Wenn es nur darum ginge, etwas bis zu Ende zu verstehen und dann rechtzuhaben, dann hätte ich keine Lust, Schriftstellerin zu sein.
Wenn es aber darum geht, dass das Leben ein Mysterium ist und ein Rätsel bleibt,
dann werde ich nicht müde, mich diesem unerklärlichen Phänomen auf immer wieder neue Weise anzunähern.“
Damit ist alles gesagt. Dazu stehe ich immer noch – und immer mehr, mit der Zeit.
Ach ja, und anders als bei anderen meiner geschätzten und von mir keineswegs beneideten Kollegen steht neben meinem Schreibgerät keine offene Rotweinflasche und kein Cognakschwenker. Ich habe alle meine Bücher bei offenem Visier geplant, geschrieben, veröffentlicht, ohne Pille, ohne Pulle. Das ist die Basis. Ich kann es mir für mich nicht anders vorstellen.
PS:
Um die Geschichte mit meinen vier Namen zusammenzufassen: Mein Pseudonym Clara Felder entstand aus Vorsicht. Katrin Panier hieß ich vor meiner zweiten Hochzeit, danach erweiterte ich mit Bindestrich um "Richter". Als ängstliche Erwägungen kompliziertester Art endgültig von mir abfielen, entschied ich mich für Einfachheit.
Und so steht seit Februar 2010 mein Name Katrin Richter im Ausweis und auf meinen Büchern!
Um die Geschichte mit meinen vier Namen zusammenzufassen: Mein Pseudonym Clara Felder entstand aus Vorsicht. Katrin Panier hieß ich vor meiner zweiten Hochzeit, danach erweiterte ich mit Bindestrich um "Richter". Als ängstliche Erwägungen kompliziertester Art endgültig von mir abfielen, entschied ich mich für Einfachheit.
Und so steht seit Februar 2010 mein Name Katrin Richter im Ausweis und auf meinen Büchern!